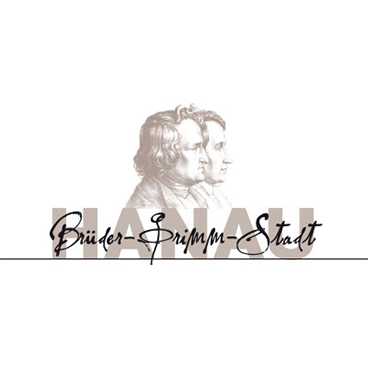Ein Jahr ist nichts
„Die Opfer vom 19. Februar sind nicht neun Menschen, es sind Hunderte.“
Diesen bewegenden Satz sagte Emiş Gürbüz, Mutter des getöteten Sedat Gürbüz, in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel. Sie meinte damit auch die Familien und vielen Freunde und Freundinnen der Opfer. Den Kreis der vom Anschlag betroffenen und traumatisierten Menschen muss man jedoch sogar noch erweitern: die Überlebenden, Ersthelfer*innen, Polizist*innen, Feuerwehrleute, Sanitäter*innen, Augenzeug*innen und Anwohner*innen der Tatorte. Die Liste ist lang und sicher nicht vollständig. Die Anzahl derjenigen, die das direkt oder indirekt Erlebte im vergangenen Jahr verarbeiten mussten, umfasst vermutlich mehr als eintausend Personen.
Laut aktueller Hirnforschung macht es keinen Unterschied, ob jemand direktes Opfer eines Anschlags oder Zeuge derartiger Geschehnisse war. Im Gehirn eines Beobachters passiert durch sogenannte Spiegelneuronen dasselbe wie bei einem Menschen, auf den eine Waffe gerichtet wird oder der mit ansehen muss, wie Anderen Gewalt angetan wird. Allein eine solche Tat und ihre Folgen zu sehen, kann sich stark auf Körper und Seele auswirken. Das beweisen die Schicksale vieler Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter. Häufig haben auch sie als Helfende im Nachhinein mit posttraumatischen Folgen zu kämpfen.
Beim Terroranschlag von Hanau hat der rechtsextreme und psychisch kranke Täter vor allem auf junge Menschen geschossen, von denen er vermutete, sie kämen aus eingewanderten Familien. Die Hanauer Diplom-Psychologin und psychologische Psychotherapeutin Sara Amiri erklärt den Effekt eines so gezielten Anschlags: „In der Psychotherapie unterscheidet man zwei Dimensionen. Die eine Dimension umfasst zufällige Traumata, wie z.B. einen Unfall. Die andere Dimension bezieht sich darauf, dass ein Trauma gezielt und bewusst durch einen anderen Menschen verursacht wurde“. Es habe schlimmste psychische Auswirkungen, wenn ein Mensch aufgrund von Faktoren wie Hautfarbe, Haarfarbe oder Herkunft angegriffen werde, so Amiri. Denn diese Eigenschaften seien unabänderlich. Der Täter hat seine Opfer und viele andere Menschen in Hanau in ihrem innersten Kern, in ihrer Persönlichkeit, ihrem Menschsein angegriffen. „Wir haben hier in Hanau auch noch die besondere Situation, dass sich viele der Todesopfer und andere vom Anschlag Betroffene kannten, ja sogar eng befreundet waren. Das heißt, die Leute sind nicht nur durch das traumatisiert, was sie erleben und bezeugen mussten, sondern haben auch noch mehrere liebe Menschen verloren. Zum Erleben einer traumatischen Situation kommt also auch noch in vielen Fällen eine erhebliche Trauerreaktion hinzu“.
Nach einem solchen Ereignis erleben die meisten Menschen zunächst eine sogenannte Akute Belastungsstörung. Betroffene zeigen dabei direkt nach einem traumatischen Erlebnis sowohl psychische als auch körperliche Symptome. Dazu gehören Panikattacken, Schlafstörungen, Herzprobleme oder andere, körperliche Schmerzen. „Man könnte sagen, es ist eine Art psychischer Schock, ein Krisenmodus, in den sich Körper und Geist begeben“, erklärt Sara Amiri. Viele Patienten fühlen sich in diesem akuten Zustand wie betäubt. Manche sind desorientiert, ziehen sich zurück. Andere wiederum können einen permanenten Unruhezustand nicht mehr verlassen. „Was diese Menschen erlebt haben, ist so überwältigend, dass das Gehirn ein paar Tage braucht, um Bilder, Emotionen, Gedanken zu sortieren“, so Amiri. „Stellen Sie sich einen Schrank vor, in den Sie üblicherweise Ihre Kleidung sehr ordentlich einsortieren. So funktioniert das Gehirn, Erlebnisse werden zusammengelegt und werden, spätestens wenn wir schlafen, an ihren Platz geräumt“. Ein Terroranschlag sei eine so massive und schreckliche Erfahrung, dass der übliche Aufräum-Mechanismus des Gehirns nicht mehr funktioniere. Ein Notfall-Modus tritt in Kraft und das Gehirn braucht wesentlich mehr Zeit, um überhaupt zu begreifen, was Körper und Geist widerfahren ist. „Betroffene leiden oft auch unter sogenannten Flashbacks. Die Kleider wurden also wirr in unseren Schrank geworfen, alles ist so durcheinander, dass die Türen sich nicht mehr richtig schließen lassen und ständig wieder aufploppen. Das sind plötzliche Rückblenden, die oftmals durch bestimmte Gerüche, Geräusche oder Orte getriggert werden. In Folge entwickeln manche Betroffenen eine Vermeidungshaltung, wollen zum Beispiel bestimmte Wege nicht mehr gehen“.
Eine solche Reaktion sei völlig normal und die massiven Symptome einer akuten Belastungsstörung verschwänden meist nach einigen Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, führt Amiri aus. „An diesem Punkt wird auch aus psychotherapeutischer Sicht nicht viel interveniert. Das wichtigste in diesem Moment ist es, eine Stütze zu sein, da zu sein, zuzuhören, Raum zu geben. Wichtiger als ein Therapeut sind hierbei Familie, Freunde, das eigene soziale Netzwerk. Ich denke, auch die Stadt Hanau hat versucht, die Betroffenen in diesem Sinne zu unterstützen“, erklärt Amiri. Bleiben die Symptome bestehen, spricht man spätestens nach sechs Monaten von einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Können die Probleme nach einem Zeitraum von zwei Jahren noch nicht bewältigt werden, kann es zu einer Persönlichkeitsstörung kommen. Nicht selten haben Betroffene dann auf Dauer mit Angststörungen, Panikattacken, Suchterkrankungen oder Depressionen zu kämpfen.
Faktoren wie das Alter, Geschlecht oder Bildungsstand hätten einen geringeren Effekt darauf wie ein Mensch ein solches Trauma verarbeiten kann, erläutert Amiri. „Viel entscheidender ist, was während des traumatisierenden Vorfalls geschieht und wie danach damit umgegangen wird“. Einige Menschen haben die Fähigkeit traumatische Erlebnisse ohne fremde Hilfe gesund zu bewältigen. Wird der Leidensdruck zu groß, kann eine Therapie helfen. „Hier geht es aber zunächst mal darum Aufklärungsarbeit zu leisten. Den Leuten zu erklären, was mit ihnen los ist, dass ihr Körper und Geist eine völlig normale Reaktion in dieser Krisensituation zeigen“, so Amiri, das helfe den meisten schon sehr. Ein Drittel der Helfer hatten nach den Anschlägen in New York am 11. September 2001 eine posttraumatische Belastungsstörung. Bei Gewaltstraftaten in Deutschland im Allgemeinen entwickelt etwa ein Viertel der Opfer und Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung. „Wir helfen am Anfang mit ganz essentiellen Dingen, wie zum Beispiel wieder schlafen können. Schlafen hilft ja, wie schon erwähnt, den Schrank in unserem Kopf aufzuräumen“. Es gehe schlicht darum den Alltag zu bewältigen, erklärt Amiri, stabil zu werden. Es gibt verschiedene Psychotherapie-Formen um solche Erlebnisse aufzuarbeiten. Aber alle Methoden zielen darauf ab, den Krisen-Modus im Gehirn aufzulösen und das Erlebte am richtigen Ort abzulegen. „Es bleibt trotzdem schrecklich und es bleibt trotzdem der schlimmste Tag im Leben desjenigen. Aber die Erinnerungen und Emotionen werden an einen geeigneten Platz im Gehirn geschoben. Das ist das Ziel.“
Um ein schreckliches Trauma wie das Erleben eines rassitischen Terroranschlags zu verarbeiten, braucht es vor allem Zeit. „Allein die Trennung von einem Partner beschäftigt uns doch oftmals viele Jahre. Wie kann man dann erwarten, dass ein solches Ereignis nach einem Jahr verdaut ist?“, fragt Amiri. „Die letzten Monate waren für alle Beteiligten sicherlich sehr kräftezehrend und der Gedenktag wird es auch sein – für die Familien der Verstorbenen, für alle Betroffenen, für alle Helfer, für ganz Hanau“, ergänzt sie.
Für Betroffene ist es das Wichtigste zu wissen, dass es Menschen gibt, die jederzeit für sie da sind. Die Forschung zeigt, dass die Unterstützung aus dem eigenen sozialen Umfeld den größten positiven Effekt darauf hat, dass ein traumatisierter Mensch sich erholen kann. Sara Amiri weist darüber hinaus auf verschiedene Beratungsangebote hin, wie zum Beispiel Therapeuten, Opferbeauftragte, der Verein Hanauer Hilfe oder der Weiße Ring. „Selbst wenn man es heute nicht schafft hinzugehen, und morgen auch nicht – irgendwann geht man vielleicht doch hin. Und da wird jemand sein, der zuhört“.